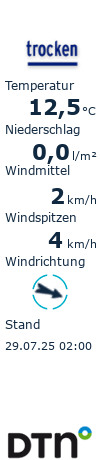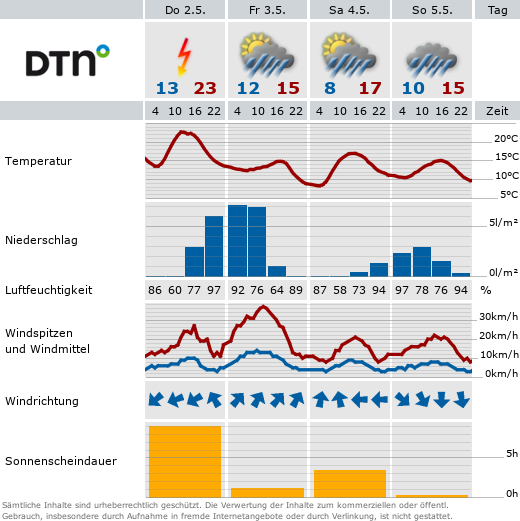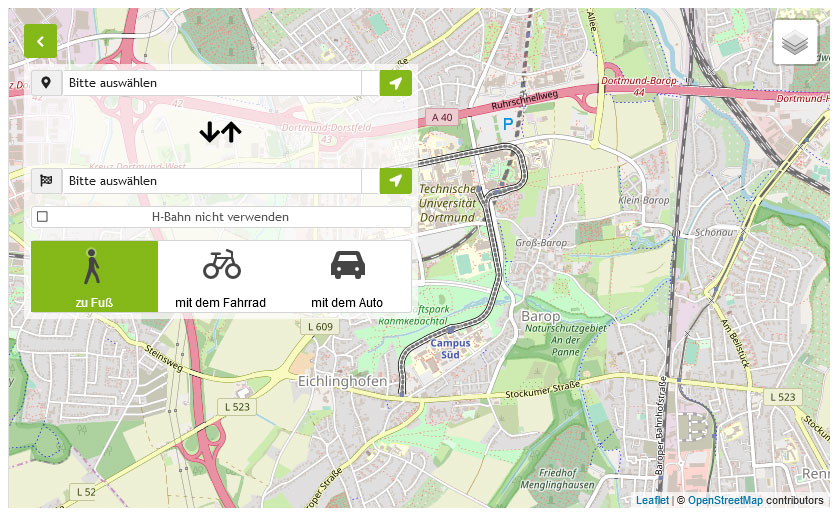Sonderforschungsbereich 1604 Produktion von Migration
Der Sonderforschungsbereich "Produktion von Migration" (SFB 1604) betreibt Migrationsforschung theoriegeleitet, postdisziplinär und reflexiv. Er erforscht, wie zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Kontexten Migration praktiziert, bearbeitet und mit Bedeutung versehen wird.
15 Teilprojekte sind den drei Medien der Produktion zugeordnet: Figuren, Infrastrukturen und Räume. Außerdem umfasst der SFB ein Integriertes Graduiertenkolleg und das Reflexivitätslabor. Das Transferprojekt wendet Perspektiven und Erkenntnisse des SFB gemeinsam mit einem Migrationsmuseum praktisch an und testet sie aus.
An dem Verbund sind neben der TU Dortmund die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, die Universität Münster, die Goethe-Universität Frankfurt a.M., die Europa-Universität Flensburg, die Universität Osnabrück und die FU Berlin in Kooperation mit dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam beteiligt.
Teilprojekt A02 Die Produktion der Diskriminierten in antirassistischen Bewegungen
Das Teilprojekt beschäftigt sich mit der Produktion von Figuren rassistischer Diskriminierung in und durch antirassistische Bewegungen in Deutschland. Diese sozialen Bewegungen haben einen immer größeren Einfluss auf öffentliche Diskurse und tragen dazu bei, dass die Themenfelder Diskriminierung und Rassismus vor allem in Medien und Politik einen Bedeutungszuwachs erfahren. Entsprechend stellen Aktivist*innen und Bewegungen aktive Ko-Produzent*innen von Wissensbeständen der Migrationsgesellschaft dar.
Die Entwicklung hin zu einer superdiversen Gesellschaft lässt sich auch in den antirassistischen Bewegungen beobachten, insbesondere durch Migration und Hybridisierung und der damit einhergehenden Diversifizierung u.a. im Hinblick auf ethnische, religiöse und Generationenzugehörigkeit. Zudem spielen soziale Lage und soziale Mobilität eine herausragende Rolle, da soziale Bewegungen in der Regel getragen werden durch Personen mit höherem sozio-ökonomischen Status. Mit zunehmender Teilhabe steigen der Gleichheitsanspruch und die Erwartung an Zugehörigkeit. Dies führt nicht zuletzt zu Neuaushandlungen von Deutungsansprüchen und Privilegien, wodurch sich soziale Konflikte, die häufig als »Kulturkämpfe« bezeichnet werden, verstärken können. Zudem lässt sich eine Internationalisierung (insb. durch die US-amerikanische Black Lives Matter-Bewegung) sowie eine zunehmende Akademisierung des Diskurses in Deutschland (auch durch die Migrationsforschung, Critical Race und postkoloniale Ansätze) beobachten. Diese vielschichtigen dynamischen Entwicklungen drücken sich in unterschiedlichen Strömungen und einer ausgeprägten Mehrstimmigkeit aus, weshalb von antirassistischen Bewegungen (im Plural) gesprochen wird.
Das Projekt geht vor diesem Hintergrund den Fragen nach, in welcher Form antirassistische Akteur*innen, insbesondere (potenziell) von Rassismus Betroffene, bestimmte Kategorien rassistischer Diskriminierung (re)produzieren und (trans-)formieren, inwiefern sich Verschiebungen zeigen und welche Folgen dies für gesellschaftliche Wissensbestände über Rassismus und Diskriminierung hat. Dabei wird auch untersucht, wie innerhalb antirassistischer Bewegungen innere und äußere Konflikte, Widersprüchlichkeiten und Widerstände verarbeitet bzw. ausgehandelt werden. Dazu werden (1) narrativ-biographische Interviews mit bekannten Aktivist*innen, (2) Analysen zu Positionen und Dynamiken innerhalb von Jugendgruppen, Kollektiven und größeren Netzwerken, (3) Analysen des spezifischen performativen Charakters des Online-Aktivismus dieser Personen und Gruppen sowie (4) leitfadengestützte Interviews mit beteiligten Außenstehenden (etwa politischen Antirassismusbeauftragten) durchgeführt. Die qualitativen Daten werden mit der dokumentarischen Methode ausgewertet.
Projektleitung
Projektmitarbeiter*innen
Projektlaufzeit
01.04.2024 - 31.12.2027 (40 Monate)
Projektförderer
DFG